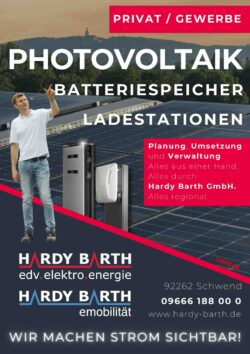Moderne Stromspeicher und regionale Fördermöglichkeiten
Das Grundprinzip ist verlockend: Mit einer Photovoltaikanlage, welche z.B. am Dach des Hauses oder der Garage installiert wird, generiert der Haushalt bzw. Betrieb seinen eigenen Strom. Während in den letzten 15 Jahren die Preise für Module teilweise um 75 Prozent sanken und der technische Fortschritt die Effizienz erhöht, bleibt ein generelles Problem bestehen: In den Momenten mit starker Sonneneinstrahlung und hoher Energieproduktion wird nicht automatisch auch der meiste Strom benötigt. Das erklärte Ziel vieler Anhänger regenerativer Energien ist deshalb „zeitliche Autarkie“. Wer nach dem Motto „Heute erzeugen, morgen verbrauchen“ handeln möchte, benötigt letztendlich eine Möglichkeit, den selbsterzeugten Strom auch zu horten – am besten nah an der Produktionsstätte.
Die dafür verwendbaren Batteriespeicher gibt es seit einiger Zeit in Serienreife: Man findet sie in knapp 17 Prozent der deutschen Ein- und Zweifamilienhäuser, seit 2020 hat sich die Zahl der neu installierten Speicher damit mehr als versechsfacht (Quelle: Prosumer-Report LichtBlick).
Wie viele andere technischen Komponenten haben Stromspeicher eine bestimmte Lebensdauer – diese liegt im Durchschnitt bei mindestens 15 Jahren, die tatsächliche Dauer hängt jedoch vom Typ der Batterie ab (z.B. Lithium-Ionen- oder Lithium-Eisenphosphat-basierte Modelle). Auch die Nutzungsart und der Aufstellort wirken sich darauf aus, wie lange ein Stromspeicher mit höchster Effizienz arbeitet. Optimalerweise sollten an einem Standort möglichst konstante Temperaturen zwischen 10 und 25 Grad und eine Luftfeuchtigkeit unter 40 Prozent herrschen. Da beim Speicherbetrieb Wärme entsteht, ist auf eine ausreichende Belüftung zu achten.
Im Landkreis Neumarkt gibt es aktuell 5.747 Heim-Speicher, ca. 450 von ihnen gehören zu Balkonsolaranlagen und haben eine Leistung von unter 2 kW. In diesem Segment wächst die Anzahl laut Landkreis-Klimaschutzmanagerin Kathrin Kimmich deutlich. Wer sich einen Strom-Speicher zulegen möchte, erhält zwar momentan keine direkte Förderung vom Freistaat Bayern, einzelne Kommunen bieten jedoch Zuschüsse für Privathaushalte, so z.B. Berching und Postbauer-Heng mit je 250 Euro pro Speicher. Sengenthal bezuschusst 50 Euro/kW (max. 500 Euro), jedoch nur für Modelle, welche mit einer reduzierten Menge seltener Erden bzw. ohne Kobalt und Nickel auskommen.
Fakt ist: Für die meisten Batterien werden wertvolle Rohstoffe verwendet. Deswegen ist eine möglichst effiziente und lange Nutzung wünschenswert. Hier wird nach wie vor geforscht. So gibt es zum Beispiel Versuche, die Akkus aus Elektrofahrzeugen nach dem Lebensende der Autos zusammenzuschalten und als stationäre Stromspeicher zu nutzen. Dabei zeigt sich: Auch wenn der fahrbare Untersatz nicht mehr straßentauglich ist, können die Batterien gerade im Verbund noch einige Jahre als effiziente Puffermöglichkeit für Haushalte dienen – u.a. da hier selten in kürzester Zeit so viel Energie abgerufen wird wie beim Beschleunigen im Straßenverkehr.